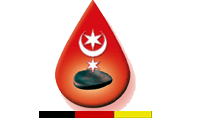Minimale Restkrankheit ist offenbar ein Parameter, mit dem sich die Rückfallgefahr einschätzen lässt.
Wenn bei Patienten mit follikulärem Lymphom nach der üblicherweise eingesetzten Einleitungstherapie keine minimale Restkrankheit mehr nachgewiesen werden kann, ist die Prognose besser. Wissenschaftler berichteten in der Fachzeitschrift Journal of Clinical Oncology darüber, dass sich die minimale Restkrankheit als ein Parameter eignet, mit dem die Prognose während der Therapie bei dieser Erkrankung abgeschätzt werden kann.
Für die Studie hatten die Forscher die Daten von Patienten ausgewertet, die an einem follikulären Lymphom, einer Form des Non-Hodgkin-Lymphoms, erkrankt waren und eine Induktionstherapie erhielten. Dabei wurden ein Anti-CD20-Antikörper und Chemotherapie eingesetzt. In der sich anschließenden Erhaltungstherapie wurde die Behandlung mit dem Antikörper fortgesetzt. Während der Induktionstherapie, an deren Ende sowie in Intervallen von vier bis sechs Monaten während der Erhaltungstherapie und Nachsorge wurde wiederholt bestimmt, ob noch minimale Restkrankheit zu finden war oder nicht.
Patienten, bei denen keine minimale Restkrankheit mehr nachweisbar war, hatten grundsätzlich eine bessere Prognose als Patienten, bei denen sich noch minimale Restkrankheit zeigte. Dabei galt: Je früher keine minimale Restkrankheit mehr nachweisbar war, desto besser für die Prognose. Die beste Prognose hatten Patienten, die schon während oder nach der Einleitungstherapie keine minimale Restkrankheit mehr aufwiesen. Wenn sich während der Erhaltungstherapie minimale Restkrankheit zeigte, war das Risiko für einen frühen Krankheitsrückfall signifikant erhöht.
Bei der Therapie möglichst früh und anhaltend zu erreichen, dass keine minimale Restkrankheit mehr nachweisbar ist, sei beim follikulären Lymphom offenbar eine Voraussetzung, um eine langfristige Krankheitskontrolle zu erhalten, so die Schlussfolgerung der Studienautoren.
Quelle:
https://www.krebsgesellschaft.de/