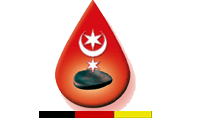Zu viel Behandlung mache den Tod qualvoller als nötig, sagt Europas wichtigster Palliativmediziner Gian-Domenico Borasio. Lebensqualität sei das Maß – gerade im Sterben.
Wie gehen Menschen damit um, dass alle sterben müssen? Wir fragen in der Serie "Der Tod ist groß" nach der Rolle des Sterbens im Leben und in der Gesellschaft. Hier haben wir mit dem Mediziner Gian-Domenico Borasio gesprochen, der Menschen im Sterben betreut.
ZEIT ONLINE: Palliativmedizinerinnen und -mediziner kümmern sich um Sterbende. Diesen Bereich betrachten viele Leute als menschlichere Medizin, da er sich stärker um die Bedürfnisse und Symptome von Patienten kümmert, als um ihre Krankheiten. Herr Borasio, ist die Palliativmedizin die bessere Medizin?
Gian-Domenico Borasio: Sie ist weder besser noch schlechter als der Rest der Medizin, sie hat nur eine andere Zielsetzung: Es geht nicht darum, das Leben der Patienten zu verlängern oder ihre Gesundheit wiederherzustellen, sondern die Lebensqualität in der letzten Lebensphase zu verbessern.
Das meint übrigens eher die letzten 24 Monate als die letzten 24 Stunden. Der Ansatz ist ganzheitlich und umfasst die physischen, psychosozialen und spirituellen Bedürfnisse der Patienten und ihrer Familien. Dafür brauchen wir mindesten fünf Berufsgruppen: Psychologen für Menschen mit Ängsten, Depressionen oder anderen psychischen Problemen, Seelsorgerinnen für existentielle und spirituelle Fragen, Sozialarbeiter, um das soziale Umfeld zu stützen, das oft noch stärker belastet ist als der Patient selbst. Und natürlich Ärztinnen und Pflegende. Dabei basiert die Palliativmedizin auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sie setzt moderne Medikamente und technische Hilfsmittel wie eine nicht-invasive Heimbeatmung, schmerzlindernde Strahlentherapie oder computergesteuerte Medikamentenpumpen ein.
ZEIT ONLINE: Viele Patientinnen berichten, dass auf Palliativstationen eine ganz andere Atmosphäre herrscht. Es gibt Zeit, es gibt eine andere Personaldecke, es gibt eine Form von Zuwendung und Wärme, die Patienten in anderen Fächern gar nicht mehr gewöhnt sind.
Borasio: Die Basis der Palliativmedizin ist etwas, das eigentlich die Basis der gesamten Medizin sein sollte, nämlich das aktive Zuhören. Es ist meine tiefe Überzeugung: Die Medizin der Zukunft wird eine hörende sein, oder sie wird nicht mehr sein.
ZEIT ONLINE: Sie haben mehr als 10.000 Menschen beim Sterben begleitet: Gibt es einen sanften Tod für die meisten Menschen?
Borasio: Der Begriff des sanften Todes ist für die Praxis wenig hilfreich. Ein Tod muss nicht sanft sein und kein Mensch muss beim Sterben loslassen, wenn er das nicht will. Wir sollten aufpassen, dass wir unsere Patienten nicht in präformierte Vorstellungen darüber hineinpressen, wie ein guter Tod auszusehen hat. Das wäre palliativer Paternalismus. Wenn es etwas gibt, was ich in vielen Jahren Palliativmedizin gelernt habe, dann dies: mich zurückzuziehen mit meinen persönlichen Vorstellungen, was für eine bestimmte Person ein guter Tod sein könnte. Der einzige, der das sagen kann, ist der Patient selbst.
ZEIT ONLINE: Aber was machen Sie dann?
Borasio: Der Dichter Rainer Maria Rilke hat das auf den Punkt gebracht: "Oh Herr, gib jedem seinen eigenen Tod", schrieb er einmal. Die Palliativmedizin will ermöglichen, dass jeder Mensch den ihm angemessenen Tod stirbt. Im Großen und Ganzen sterben die Menschen dabei so, wie sie gelebt haben. Und der eigene Tod kann sehr unterschiedlich aussehen. Ein Beispiel: Wir hatten einmal eine Patientin, die mit Krebs im Endstadium zu uns kam. Sie hatte Schmerzen, Atemnot und viele andere Symptome. Wir haben uns um alles gekümmert, aber trotzdem gab es während jeder Visite ein Riesentheater, nichts war ihr gut genug. Gleichzeitig hatten wir aber den Eindruck, dass unsere Therapie wirkt. Und dann erzählte uns der Seelsorger, dass die Dame in ihrer Jugend eine große Operndiva war. Da wurde uns klar, dass ihr ganzes Leben ein großes Theater gewesen war und dass die letzte Aufführung auch nicht anders werden würde. Das hat uns in der weiteren Begleitung sehr geholfen.
ZEIT ONLINE: In der Medizin wird manchmal ein Schaden in Kauf genommen, um zu einer Heilung oder einer Verlängerung des Lebens zu kommen. Zum Beispiel während einer Chemotherapie. Schließt die Palliativmedizin all das aus?
Borasio: In der Palliativmedizin können wir den Patienten keine Heilungschancen anbieten, wir setzen aber auch nichts ein, was der Lebensqualität des Patienten schaden kann. Auf einem anderen Blatt steht, dass gute Palliativmedizin erstaunlicherweise lebensverlängernd wirkt. Es gibt eine berühmte Studie aus den USA, die zwei Patientengruppen mit fortgeschrittenem metastasiertem Lungenkrebs miteinander verglichen hat, also einer sehr schweren Erkrankung mit kurzer Lebenserwartung (New England Journal of Medicine: Temel et al., 2010). Die eine Gruppe erhielt frühzeitig eine palliative Versorgung, die andere nicht. In der Palliativgruppe hatten die Menschen eine bessere Lebensqualität, waren weniger depressiv und bekamen weniger Chemotherapien am Lebensende. Aber das erstaunlichste Ergebnis dieser Studie war: Diese Gruppe von Patienten lebte auch drei Monate länger
ZEIT ONLINE: Wie erklärt man sich das?
Borasio: Es ist zum einen schon lange bekannt, dass das psychologische Wohlbefinden mit der Überlebenszeit zusammenhängt. Eine zweite Hypothese aber ist: Viele Krebspatienten bekommen am Lebensende Therapien, Chemotherapien oder Bestrahlungen zum Beispiel, die sie eigentlich nicht mehr vertragen können. Durch Übertherapie am Lebensende sterben wir nicht nur schlechter, sondern auch früher. Überspitzt formuliert, könnte man die Übertherapie am Lebensende als die häufigste Form der aktiven Lebensverkürzung in Deutschland bezeichnen.
ZEIT ONLINE: Das ist eine starke These. Gibt es ähnliche Erkenntnisse auch von anderen Erkrankungen?
Borasio: Studien, die nach einem ähnlichen Effekt suchen, laufen gerade. Aber die US-amerikanische Studie deckt sich mit unseren klinischen Erfahrungen. Wir bekommen täglich Patienten mit stärksten Beschwerden auf die Palliativstation verlegt, die vermeintlich im Sterben liegen. Wir streichen dann alle unnötigen Medikamente und konzentrieren uns auf die Behandlung der belastenden Symptome. Und zwei Wochen später können die Patienten nach Hause zurückkehren. Die Übertherapie ist in den industrialisierten Ländern leider flächendeckend verbreitet. Als Palliativmediziner haben wir die Möglichkeit, das Gesundheitssystem vom Ende her zu überblicken, denn die Leute kommen mit sehr langen Krankengeschichten und vielen, nicht immer guten Erfahrungen zu uns.
ZEIT ONLINE: In der letzten Lebensphase, den letzten zwei oder drei Jahren wird mindestens ein Drittel der gesamten Ausgaben für die Gesundheit eines Menschen verbraucht.
Borasio: Ja, wir sprechen hier für Deutschland jährlich von dreistelligen Milliardenbeträgen. Wenn man die lebensverlängernde Wirkung vieler Krebsmedikamente mit der Wirkung der Palliativmedizin vergleicht, gibt es keinen Unterschied. Aber einige dieser Medikamente kosten 100.000 Euro und mehr und haben starke Nebenwirkungen. Die US-Daten zeigen hingegen, dass die Palliativmedizin dem Gesundheitssystem – unter anderem durch die Vermeidung von unnötigen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen – im Schnitt jeden Tag 117 US-Dollar pro Patient spart.
ZEIT ONLINE: Bei solchen Fragen wird es schnell politisch.
Borasio: Die Palliativmedizin ist ein sehr politisches Fach, denn sie legt den Finger in die Wunden der modernen Medizin. Wir sind die Umsatzkiller schlechthin, weil wir am Lebensende, also dort, wo die Gesundheitsindustrie am meisten verdient, die unbequeme Frage stellen, ob immer alles sinnvoll ist, nur weil es machbar ist.
ZEIT ONLINE: Gleichzeitig gibt es in bestimmten Bereichen der Medizin eine Unterversorgung, also zu wenig Ärztinnen und Ärzte und keinen Zugang zu bestimmten Therapien. Ist das für Sterbende nicht genauso schlimm?
Borasio: Die Kehrseite der Übertherapie ist die Unterversorgung, auch durch mangelnde Pflege. Besonders gefährdet sind hier Hochbetagte und unterprivilegierte Menschen. Wenn wir so weitermachen, besteht die Gefahr, dass wir bald nur noch überversorgte oder unterversorgte Patienten im System haben. In der Schweiz bekommen Privatpatienten doppelt so oft eine Chemotherapie in den letzten 30 Lebenstagen wie gesetzlich Versicherte, was meist keine gute Idee ist. Auch wenn es paradox klingt: Wenn sie nur die Wahl zwischen den zwei Extremen haben, ist es am Lebensende eindeutig besser, unterversorgt als überversorgt zu sein.
ZEIT ONLINE: Aber es sind ja nicht allein die Versicherungen und die Gesundheitsindustrie, die das Sagen haben. Wie wir das Gesundheitssystem strukturieren, ist doch vor allem eine politische Frage.
Borasio: Das ist richtig. Aber die Lobbyisten sind sehr mächtig. Das System versucht die Palliativmedizin zu domestizieren, ihre verändernde Kraft abzuschwächen und sie letztlich zu einem weiteren pharmafreundlichen, schmerzmittelverschreibenden Fach zu machen. In Deutschland ist die Palliativmedizin zu weiten Teilen faktisch anästhesiert, also gewissermaßen betäubt. Eine weitere, sehr schlaue Strategie des Systems besteht darin, die Palliativmedizin als eine ethisch besonders hochstehende Disziplin darzustellen, sozusagen als die Gutmenschen-Medizin. Das führt zum einen zu einer schleichenden Marginalisierung und zum anderen unweigerlich zur bitteren Enttäuschung: Palliativmediziner sind nämlich nicht ethischer als alle anderen Ärzte.
ZEIT ONLINE: Wie sähe für Sie denn eine gute Fortentwicklung des Fachs aus?
Borasio: Was wir dringend brauchen, ist eine bessere Finanzierung von palliativmedizinischen Konsiliardiensten in Krankenhäusern. Das sind Ärzte, die auf verschiedenen Stationen Patienten palliativmedizinisch mitbetreuen und die behandelnden Ärzte beraten. Und die Palliativmedizin muss in die Köpfe aller Ärzte. Inzwischen ist sie zum Glück Pflichtfach im Medizinstudium in Deutschland und der Schweiz. Im ambulanten Bereich wurde in Deutschland durch die Einführung der spezialisierten ambulanten Palliativteams schon viel erreicht. Menschen sollten im Allgemeinen und auch am Lebensende möglichst wenig in Krankenhäusern sein. Wir müssen aber aufpassen, dass wir diese Palliativteams nicht den Gesetzen des Marktes unterwerfen, denn das birgt das Risiko von Dumpingpreisen und schlechter Versorgung. Palliativbetreuung ist, wie die Gesundheit schlechthin, ein Menschenrecht und keine Ware.
ZEIT ONLINE: Ist die Diskussion nicht komplexer? Die Umstrukturierung des Gesundheitssystems ist ja in einigen Bereichen sinnvoll. So hat man vor 15 Jahren Tagespauschalen durch Fallpauschalen ersetzt, nach denen Krankenhäuser für bestimmte Krankheitsbilder eine pauschale Entlohnung von den Krankenkassen bekommen. Die Liegedauer von Patienten konnte dadurch verringert werden. Und das ist oft gut, denn je länger ein Patient zum Beispiel auf Station liegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich einen multiresistenten Keim einfängt. Letztlich ging es also auch um Effizienz, die gesundheitsfördernd ist. Braucht es also wirklich eine Änderung des ganzen Systems oder brauchen wir Änderungen spezifisch für die Palliativmedizin?
Borasio: Das stimmt, in manchen Bereichen funktionieren die Fallpauschalen prächtig, in der Orthopädie bei Knieprothesen beispielsweise. Aber auf Palliativstationen ergeben sie einfach keinen Sinn. Das Ziel der Verkürzung der Liegedauer führt hier, wo mindestens die Hälfte der Patienten stirbt, zu einem fürchterlichen Fehlanreiz hin zum fallpauschalenverträglichen Frühableben. Die Australier, von denen die Deutschen das Fallpauschalensystem übernommen haben, haben die Palliativmedizin von Anbeginn an aus dem System genommen. Das sollte uns zu denken geben.
ZEIT ONLINE: In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist die Palliativmedizin immer populärer geworden. Hat das mit unserer Angst vor dem Tod und Sterben zu tun?
Borasio: Auf der einen Seite steht die Angst vor dem Tod, die untrennbar mit bestimmten Fragen verbunden ist: Was kommt nach dem Leben? Wird mein eigenes Ich ausgelöscht oder existiert es in irgendeiner Form weiter? Diese Angst können wir leider nicht verringern, denn wir wissen genauso wenig wie unsere Patienten, was danach kommt.
Auf der anderen Seite steht die Angst vor dem Sterben, also davor, dass die letzte Lebensphase qualvoll verläuft. Diese Angst können wir den Menschen dank der Fortschritte in der Palliativmedizin tatsächlich weitgehend nehmen. Und es ist wichtig, diese Information weiterzugeben. Denn indem wir diese Angst vermindern, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit eines guten Verlaufs der letzten Lebensphase.
Quelle:
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2018