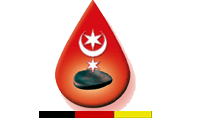Krebs ist eine lebensbedrohliche Situation. Die Therapie hinterlässt körperliche Narben, aber auch seelische, die oft vernachlässigt wurden. Bis jetzt. Warum die noch junge Psychoonkologie nicht nur für die Patienten ein Segen ist.
"Auf einer Skala von 1 bis 10 – Wie geht es Ihnen?"
"Auf einer Skala von 1 bis 10 – wie stark fühlen Sie sich belastet?",
"Haben Sie minderjährige Kinder?"
"Wünschen Sie sich psychologische Unterstützung?"
Jährlich füllen Tausende Patienten im Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf diesen kleinen Fragebogen aus. Die meisten unter Schock. Ihnen wurde gerade gesagt, dass sie Krebs haben.
"Krebs hat Traumapotenzial. Trauma heißt, die uns mental stützende Struktur ist angeschlagen, in manchen Fällen gar zerbrochen", sagt Frank Schulz-Kindermann. Bei ihm landen die Fragebögen. Der eine bärige Gelassenheit ausstrahlende Sechziger leitet die Psychoonkologische Spezialambulanz der Hamburger Uniklinik.
Die Psychoonkologie ist eine vergleichsweise junge Institution in der Krebstherapie, deren Vorgehen sich im Kern wenig verändert hat: Alles bösartige Gewebe großflächig herausschneiden und das Areal anschließend mit Chemie oder Strahlen "beschießen". Krebs ist in der Umgangssprache mit kriegerischen Attributen versehen. Da ist von Kampf gegen den Krebs die Rede, der mal besiegt und mal verloren wird. Vom Ringen mit der heimtückischen Krankheit und dem Verlust an Lebensqualität. Die martialischen Metaphern zeigen deutlich, wie extrem anstrengend die Prozedur ist. Wie bei allen Kämpfen hinterlässt sie keineswegs nur körperliche Narben, sondern auch seelisch. Zwar forscht die Psychologie seit den siebziger Jahren verstärkt am Zusammenhang von Psyche und Heilung bei Krebs, doch erst seit zehn Jahren gibt es Leitlinien der Deutschen Krebsgesellschaft zur Fort- und Weiterbildung zum Psychoonkologen.
Psychologen mit Krebserfahrung
"Als ich anfing, wurde man als Psychologe von den Ärzten auf der Onkologie eher geduldet und kaum ernst genommen", erinnert sich Schulz-Kindermann. Heute sei das völlig anders. Die Psychoonkologie ist mittlerweile ein fester Bestandteil in der Krebstherapie. Um Patienten in ihrer lebensbedrohlichen Situation überhaupt glaubwürdig unterstützen zu können, müssen sich die Psychologen zunächst selbst intensiv mit Krebs beschäftigen. Krebs ist als Begriff so ungenau wie "Auto" für alles mit vier Rädern. Tumore kommen in den unterschiedlichsten Arten und Ausprägungen vor, und für jeden gibt es eigene Operationen und Therapien.
Um die Komplexität dieser Erkrankung zu verstehen, verbringen die angehenden Psychoonkologen an der Uniklinik bis zu 600 Stunden im Betrieb der Onkologie. Sie lernen dort die medizinische Seite des Kampfes gegen den Krebs kennen, vor allem aber die menschliche. Manche Tumore sind ausgezeichnet heilbar, andere trotz allen medizinischen Fortschritts nicht. Wer sich als Psychologe auf die Onkologie spezialisiert, muss sich mit dem Überleben ebenso gut auskennen wie mit dem Sterben.
Wöchentlich werden in der Spezialambulanz die Fragebögen der neuen Patienten ausgewertet. Manche haben erst vor Stunden von ihrer schweren Erkrankung erfahren, andere wissen es schon länger und sind zur Therapie im Krankenhaus. "Wir besuchen die Betroffenen dann auf der Station um zu sehen, wie wir helfen können", sagt Schulz-Kindermann. Dann wird der Patient zum Erstgespräch eingeladen.
Jeder Krebs ist anders
Der Psychoonkologische Dienst liegt abseits von aller Hektik am Rande des großen Klinikkomplexes mitten im Grünen. Nach diesem ersten Gespräch legen Schulz-Kindermann und sein Team fest, welcher Therapeut am besten zu welchem Patienten passt. "Kompetent sind alle, doch manchmal fühlt sich ein älterer Patient bei einem jungen Therapeuten eher unwohl – und umgekehrt. Auch sollte sich der Therapeut mit der betreffenden Krebsart auskennen, um sich bestmöglich in die Situation des Patienten einfühlen zu können", erklärt Schulz-Kindermann. Ein Lungenkrebs bringt schließlich andere Belastungen mit sich als Prostatakrebs oder eine Leukämie unter einer Stammzellentherapie.
Für den Patienten ist ein zu ihm passender Therapeut entscheidend, denn beide bleiben auf dem weiteren Weg zusammen. Die Gespräche werden nicht als Therapie bezeichnet, sondern als das, was sie sind: eine Begleitung. "Krebs ist eine absolute Lebensgefahrensituation. Auch wenn die Heilungschancen in sehr vielen Fällen ausgezeichnet sind, scheint für die Patienten das alte Leben beendet und ein Neues noch nicht in Sicht", weiß Schulz-Kindermann. Die Psychoonkologie könne bei der Wegfindung helfen und neue Perspektiven aufzeigen – nicht nur für die Patienten, sondern gleichermaßen für die Angehörigen.
Oft kommen der Partner mit, manchmal sogar die Familie
So seien Paargespräche nicht ungewöhnlich, manchmal käme sogar die ganze Familie mit. Schließlich befänden sich alle auf neuem Terrain, wüssten nicht, wie man miteinander umgehen soll, wie belastbar der erkrankte Partner sein wird und wie womöglich die Rollen im Familienleben neu besetzt werden. "Hier kann ein offenes Gespräch sehr hilfreich sein, von vornherein Missverständnisse auszuräumen", so Schulz-Kindermann.
Die Psychoonkologie an der Hamburger Uniklinik ist Teil des sogenannten Cancer Centers, einem Kompetenznetzwerk, das alle Bereiche der Krebstherapie abdeckt: vom "Onkolotsen", der als erste Anlaufstelle Krebserkrankte an die Hand nimmt über die Chirurgie sowie Therapie bis hin zur Betreuung in der Zeit danach.
Krebs bei Teens: Wie eine Vollbremsung auf der Startbahn ins Leben
Insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen hat sich in der psychologischen Begleitung viel getan. Jugendliche fegt der Krebs geradezu von der Startbahn des Lebens. Eine Vollbremsung ausgerechnet in dieser so prägenden Zeit des Selbstfindens und Ausprobierens. Für sie gibt es daher eigene Programme mit Musik- und Kunsttherapie, Tipps zur Ernährung, Sportangeboten und Coaching für den Wiedereinstieg in Schule, Studium oder die Berufsausbildung.
Die meisten Menschen stabilisieren sich indes auch ohne Begleitung. Studien zufolge fühlten sich 70 Prozent der Krebspatienten zwar eine Zeit lang aus ihrem gewohnten Leben gerissen, doch langfristig nicht außergewöhnlich belastet. Gelegentlich, weiß Frank Schulz-Kindermann, kommen die Auswirkungen zeitverzögert. "Die Seele braucht länger. Man schließt sie weg, konzentriert sich allein auf die Behandlung und seine körperliche Genesung", berichtet der Psychologe. Für das Umfeld meist völlig überraschend setzen ein Jahr nach der Therapie plötzlich Angstzustände oder Depressionen ein. Das gelte vor allem für Patienten, die anstrengende, ja gefährliche Therapien über sich ergehen lassen mussten, etwa bei der Transplantation von Stammzellen.
Leben mit dem Krebs für viele Jahre
Doch ungeachtet steigender Heilungschancen geht die Sache manchmal nicht gut aus. Dann ist es eine Begleitung bis zum Tod. Ein Weg, den Psychoonkologen mit ihren Patienten immer häufiger gehen müssen und das ist, so paradox es auch klingen mag, im Grunde eine gute Nachricht. Durch die enormen Fortschritte in der Medizin leben Krebspatienten auch ohne Hoffnung auf Heilung noch sehr viele Jahre mit Lungenkrebs, Darmkrebs oder metastasierendem Brustkrebs. "Noch vor zehn Jahren hatten wir mit solchen Patienten wenig Kontakt, weil sie so schnell starben. Hier hat die Palliativmedizin neue Räume geöffnet.", erklärt Schulz-Kindermann.
Die fortwährende Auseinandersetzung mit dem Sterben stellt die Menschen im Psychoonkologischen Dienst vor ganz eigene Herausforderungen. Sie müssen auf einem Grat wandern, zwischen Sensibilität für den Patienten und professionellem Selbstschutz. "Natürlich gehen einem die Schicksale oft nahe. Vor allem die der jungen Krebspatienten", sagt Frank Schulz-Kindermann nachdenklich. Daher seien die gemeinsamen Rituale bei der Trauerbewältigung für das Team so wichtig. Für jeden verstorbenen Patienten werde eine Besinnungsminute abgehalten. Ein kurzer Druck auf die Stopptaste des Alltags, damit der Verstorbene nicht zur beruflichen Routine wird.
Wir sollten mehr über Krebs reden
Reden über den Krebs fällt vielen schwer. Oft wird die Krankheit umschrieben oder gar geheim gehalten. Freunde ziehen sich zurück, unsicher wie sie mit den Betroffenen umgehen sollen. Vielleicht auch, um sich vom Thema fernzuhalten. Schließlich liegt die statistische Wahrscheinlichkeit einer eigenen Krebserkrankung bei knapp 50 Prozent. Wer will daran schon gern erinnert werden?
Doch es scheint, als zeichne sich ein Wandel ab. Prominente und Politiker gehen immer häufiger mit der Diagnose in die Öffentlichkeit. Wie die Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein Manuela Schwesig oder Erwin Sellering, der ehemalige oberste Minister von Mecklenburg-Vorpommern. Auch Hessens Landeschef Volker Bouffier sowie der thüringische CDU-Landeschef Mike Mohring sprachen frei über ihre Erkrankung. Und Wolfgang Bosbach macht seit Jahren keinen Hehl aus seinem Prostatakrebs. Die neue Offenheit ist insbesondere für Politiker bemerkenswert, einem Berufsstand in dem Krankheit eher als Schwäche betrachtet wird.
Eine neue Offenheit im Umgang mit der Volkskrankheit Krebs wäre wünschenswert. Und reden hilft. Auch Jahre später. "Es gibt Patienten, die kommen, obwohl geheilt, oft noch Jahre später zu mir. Nur so, um über die Zeit damals und ihr Leben heute zu reden", berichtet Schulz-Kindermann. Über bestimmte Themen kann man vielleicht nur mit Menschen reden, die einen auf einer gefährlichen Reise ein Stück begleitet haben.
Quelle: