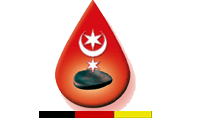Der Datenbedarf ist riesig, der Dokumentationsaufwand auch: Bei keiner anderen Indikation ist der Nutzen von Digitalisierung so offensichtlich wie beim Krebs. Diskussionsbedarf besteht beim Datenschutz.
Berlin. Aus eigener Erfahrung weiß Alexandra von Korff, Geschäftsführerin von yeswecan!cer, was wichtig ist, wenn eine Krebsdiagnose über einen Menschen hereinbricht: Alle relevanten Daten müssen beisammen sein, und es besteht ein großer Bedarf an Austausch mit anderen Betroffenen. „Ich sehe das deswegen sehr positiv, dass wir jetzt über elektronische Patientenakten reden. Wenn es einen selbst betrifft, dann ist man sehr glücklich, Daten teilen zu können.“
Gleichzeitig hat yeswecan!cer eine App entwickelt, die es Krebspatienten ermöglicht, sich untereinander und mit Angehörigen digital zu vernetzen. „Bei Brustkrebs ist es noch relativ einfach, andere zu finden. Je seltener die Krebserkrankung, desto schwieriger wird es, da sind digitale Lösungen wirklich das Nonplusultra.“
Die elektronische Patientenakte und Vernetzungs-Apps wie jene von yeswecan!cer sind zwei Komponenten von etwas, das künftig einmal eine Art „digitales Ökosystem“ für die Krebsversorgung werden könnte. Über diese stark digitale Zukunft der onkologischen Versorgung diskutierten Patienten, Ärzte und Industrievertreter jetzt bei dem von Springer Medizin, Pfizer und Roche ausgerichteten Forum OnkoDigital in Berlin.
Besseres UAW-Management
Aus ärztlicher Sicht berichtete Dr. Oliver Schmalz, Chefarzt für Hämatologie/Onkologie am Helios Klinikum Wuppertal, über die dortigen Bemühungen um ein besseres Management unerwünschter Nebenwirkungen neuerer Krebstherapien vom Tyrosinkinasehemmer bis zur Immuntherapie. Eine wichtige Komponente dabei waren zum einen speziell geschulte Krankenpflegekräfte.
Außerdem wurde im Rahmen einer Studie eine App eingesetzt, mit der Patienten ihre Nebenwirkungen erfassen konnten: „Ich war da kritisch, dachte, oh je, noch mehr Informationen, Doppeldokumentation. Ich habe mich dann aber darauf eingelassen, und es war richtig toll. Wir haben Patienten frühzeitig erkannt, wir wussten vorher, was wir tun müssen, wenn die Patienten in die Ambulanz kamen. Wir haben auch Ambulanzzeit eingespart, und vor allem haben sich die Patienten extrem gut betreut gefühlt. Ich bin jetzt überzeugt, dass das der Weg ist, den wir weiter gehen müssen.“
Potenzial für Qualitätsmanagement
Digitale Anwendungen in der Onkologie dienen allerdings nicht nur dem unmittelbaren Management der Patienten. Sie können auch Vehikel sein, um Lebensqualitäts- und Symptomdaten aus der realen Versorgung für eine Qualitätssicherung und auch zum Beispiel für eine Arzneimittelnutzenbewertung zu erheben. Solche „patient-reported outcome measures“ oder PROMs sind einer der Gründe, warum sich nicht zuletzt pharmazeutische Hersteller onkologischer Therapien für die Digitalisierung stark interessieren. Wie genau sich onkologische, krankheits- oder therapiebegleitende Apps in die digitale Versorgungslandschaft bei Krebserkrankungen eingliedern, ist derzeit freilich noch offen. Die neue Bundesregierung wird hier Entscheidungen treffen müssen. Denkbar wäre zum Beispiel, dass solche Apps regelhaft als BfArM-zertifizierte, digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) in den Markt kommen. Zwei von derzeit 24 Apps im DiGA-Verzeichnis, Cankado und Mika, sind onkologische Apps.
Können Daten für die Forschung zugänglich gemacht werden?
Zu den ungelösten Fragen zählt, ob und wie mit derartigen Apps erhobene Daten dann auch für eine anwendungsbegleitende Forschung zugänglich gemacht werden können. Ein theoretischer bzw. gesetzlich angelegter Weg über die elektronische Patientenakte und von dort aus über eine freiwillige Datenspende hin zu einem erneut beim BfArM angesiedelten Forschungsdatenzentrum existiert.
Das ist bisher allerdings nicht mehr als Theorie, es fehlt noch an Schnittstellen und nicht zuletzt an Patientenakten. Das wird sich aber in den nächsten Jahren ändern. Es gibt bisher auch noch keinen unkomplizierten Weg für Industrieunternehmen, den beim BfArM gesammelten Versorgungsdaten zu forschen. Auch hier sehen viele noch Diskussionsbedarf. „Klar ist, dass wir eine gesellschaftliche Diskussion über Patientenschutz und Datenschutz brauchen“, sagte Daniel Cardinal, Leiter Versorgungsinnovation bei der Techniker Krankenkasse. „Wenn immer alles zu tausend Prozent sicher sein muss, dann werden wir keinen Fortschritt für die Versorgung erzielen.“
Quelle: