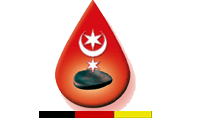Unterschiedliche Auslegungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung lassen Wissenschaftler verzweifeln. Betroffen sind unter anderen die jüngsten unter den Krebspatienten.
Berlin. Datenschutz und Richtlinien-Chaos in der Europäischen Union verzögern den medizinischen Fortschritt und gefährden Heilungschancen vor allem junger Krebspatienten. Die unterschiedliche Auslegung von Regularien wie der Datenschutzgrundverordnung stellt die Forschung, aber auch die Therapie zunehmend vor Herausforderungen.
Am kommenden Dienstag entscheidet das Europaparlament über den Abschlussbericht eines Sonderausschusses „Krebsbekämpfung“. Kern seiner Forderungen ist die Einrichtung eines Sonderbeauftragten oder eines entsprechenden Gremiums, um die Zusammenarbeit in Sachen Gesundheit auf europäischer Ebene endlich zu harmonisieren und auf Wesentliches fokussieren. Unter anderem soll die Patientenfreizügigkeit in den Mitgliedsländern und die Unterstützung von Me-too-Präparaten zugunsten von Durchbruchsinnovationen gestärkt werden. Zudem sollen Forschungs-Ausschreibungen von überflüssigen Vorgaben entschlackt werden. Zumindest teilweise sollen diese Ziele mit einer Umsetzungsagenda verknüpft werden.
„Wir schützen Daten besser als unsere Kinder“
„Man gewinnt den Eindruck, wir schützen unsere Daten besser als unsere Kinder“, sagte die Kinderonkologin Professor Angelika Eggert am Freitag bei einem gemeinsamen Pressegespräch mit dem Europaabgeordneten und Arzt Dr. Peter Liese (EVP). Der Datenschutz dürfe nicht so strikt gehandhabt werden, dass wir nicht weiterkommen mit unseren medizinisch-wissenschaftlichen Aufgaben, forderte Eggert. Die an der Charité forschende Onkologin koordiniert die deutsche Neuroblastom-Studiengruppe, die an einer europaweiten klinischen Studie für Hochrisiko-Neuroblastome teilnimmt, einer häufig tödlich verlaufenden Krebserkrankung von Kindern. 19 EU-Länder sind beteiligt.
Umweltfaktoren spielten in der Kinderonkologie praktisch keine Rolle. Gleichwohl gäben Ausschreibungen vor, diese besonders zu berücksichtigen. Damit gingen sie am Bedarf vorbei, die Kinderonkologie könne aus dem Rennen fallen, warnte Eggert.
Forschungsverbünde verlieren Zeit
Es gehe immer darum, dass die Patienten vor der Nutzung ihrer Daten durch die Wissenschaft dazu auch ihre Einwilligung gegeben haben. „Wir wollen nicht, dass etwas passiert, ohne dass der Patient Bescheid weiß“, sagte Liese. Wie mit diesen Einwilligungen umgegangen werde, sei allerdings in Deutschland anders geregelt als in Frankreich oder den Niederlanden. „Man kann darüber schier verrückt werden, weil man in den europäischen Forschungsverbünden immer wieder Zeit verliert“, klagte Liese. Was Deutschland verlange, sei unter Umständen in Frankreich verboten. Eine Zusammenarbeit sei dann zum Nachteil der Patienten nicht erlaubt.
Gerade für die Kinderonkologie sei die europäische Zusammenarbeit essenziell. In Deutschland gebe es rund 2300 Neuerkrankungen im Jahr, europaweit etwa 15.000 Neu-Diagnosen, betonte Eggert. Als Einzelland seien klinische Möglichkeiten daher kaum möglich.
Anders als Erwachsene litten Kinder in der Regel nicht unter Karzinomen, sondern eher unter Leukämien, bestimmten Hirntumoren und Blastomen. Bei Studien, die nur in Deutschland durchgeführt würden, müsse mit einer Laufzeit von zwölf bis 15 Jahren gerechnet werden. Das sei für ein derart „dynamisches Gebiet“ kein praktikabler Innovationszyklus. Bei der Seltenheit der Erkrankungen sei Europa nur gemeinsam ein interessanter Partner für die Pharmaindustrie. Fortschritte gebe es vor allem bei den Leukämien, was vor allem an den KT-Zell-Therapien liege. „Wir lernen, dass dies aber nicht für alle Patienten gilt“, sagte Eggert. In Berlin werde nun an Weiterentwicklungen dieser Therapie geforscht, in die über Stammzelltransplantationen auch das Immunsystem der Eltern einbezogen werde.
Liese: „Völlige Katastrophe“
Chemo in einem anderen Land, oder gar eine Operation seien auch in einem vereinten Europa kaum möglich. Das Gesundheitswesen leide an der europäischen Bürokratie, sagte Peter Liese. An viele Stellen reiche die Europäische Richtliniue nicht weit genug. Fast jeder Patient, der sich in einem anderen EU-Land behandeln lassen oder auch nur eine zweite Meinung einholen wolle, lande vor dem Europäischen Gerichtshof. „Es ist eine völlige Katastrophe“, fasste Liese zusammen.
Quelle: