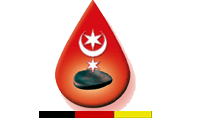Winfried Hardinghaus ist Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands. Im Interview erzählt er, warum der Tod immer noch ein Tabuthema ist und was das Sterben leichter macht.
Herr Hardinghaus, sterben muss jeder, aber die meisten Menschen scheinen sich nur widerwillig mit dem Tod zu beschäftigen. Warum ist das so?
Winfried Hardinghaus: Der Tod ist immer noch ein Tabuthema. Ich bin selbst Arzt und stelle sogar bei Kollegen fest, dass sie sich kaum Gedanken darüber gemacht haben, wie sie sterben möchten und welche Möglichkeiten der Begleitung es gibt. Aber auch in anderen Zusammenhängen, beruflich und privat, erlebe ich oft, wie groß der Unwille ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Entsprechend groß ist der Aufklärungsbedarf. Vergangenes Jahr haben wir vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband eine Umfrage gemacht, die ergeben hat, dass nur 18 Prozent der Menschen in Deutschland wissen, dass ein Platz in einem stationären Hospiz für die Betroffenen kostenlos ist.
Wie erklären Sie sich diesen Unwillen?
Ich glaube, es stecken letztlich Ängste dahinter. Die Angst vor dem eigenen Tod und allem, was bis dahin vielleicht durchlitten werden muss. Es ist unangenehm, darüber nachzudenken, und eigentlich wirkt es ja auch noch weit weg, also schiebt man es lieber beiseite. Ich muss aber auch sagen: Es ist schon deutlich besser geworden. Als wir angefangen haben mit der Hospiz- und Palliativbewegung in Deutschland in den 1980er-Jahren, da war der Widerstand noch größer. Die Bereitschaft, über das eigene Sterben nachzudenken, wächst.
Das ist auch der Öffentlichkeitsarbeit der Hospize zu verdanken, die sich darum bemühen, das Sterben als Teil des Lebens anzuerkennen. Gelingt das?
Das Image der Hospize hat sich in den vergangenen zehn Jahren weiter gebessert. Früher wurden Hospize ja auch schon mal Sterbeheime genannt, da hatten die meisten Menschen düstere Bilder im Kopf. Mehr denn je bemühen sich die Häuser darum, wohnlich und sehr menschlich zu sein. Es geht darum, das verbleibende Leben zu gestalten, und nicht darum, den Tod vorzubereiten. Wer heute ein Hospiz besucht, spürt das.
Das Lebensende so angenehm wie möglich zu gestalten, das ist der Leitgedanke heutiger Hospize. Wie sind sie entstanden?
Der Gründung der ersten Hospize ging die Beobachtung eines Mangels voraus. Lange Zeit wurde kein Wert auf Sterbebegleitung gelegt. In den Krankenhäusern wurden die Sterbenden wortwörtlich abgeschoben, also in anonyme Räume gebracht, um sie dort sterben zu lassen. Die medizinische Versorgung wurde oft frühzeitig abgebrochen, weil man fand, der Patient habe schon genug Morphin bekommen oder weil man unsinnigerweise eine Abhängigkeit befürchtete. Die Hospizbewegung war ein Gegenentwurf zu dieser mangelnden Fürsorge. Ehrenamtliche haben angefangen, sich besser um die Sterbenden zu kümmern – erst in der häuslichen Umgebung oder in Krankenhäusern, später in darauf spezialisierten Häusern: den Hospizen. Es sollte einen sicheren Ort geben, an dem Menschen ihr Leben würdevoll zu Ende bringen können.
Auch im Hospiz werden die Menschen medizinisch versorgt. Der Satz „Wir können nichts mehr für Sie tun“ stimmt also nicht?
Gesundmachen im herkömmlichen Sinne kann die Medizin einen unheilbar Kranken nicht – insofern gelangen gewisse Fachrichtungen tatsächlich irgendwann ans Ende ihrer Möglichkeiten. Medizinisch kann trotzdem noch viel getan werden. Die Palliativversorgung kann Schmerzen lindern und Symptome erträglich machen. Sie kann helfen, einem Menschen viel Leid zu ersparen, nicht zuletzt auch seelisch.
Sie sprachen gerade von Würde – was ist würdevolles Sterben für Sie?
Jemandes Würde zu achten, bedeutet für mich, ihn so sein zu lassen, wie er ist. Das gilt im Leben wie auch im Sterben. Für mich als Arzt heißt das, zu respektieren, wenn er auf bestimmte Medikamente verzichten möchte. Jemandem Würde zuzugestehen bedeutet aber auch, ihm seine Schmerzen oder seine Luftnot zu nehmen. Und es bedeutet, ihm dabei zu helfen, seine Selbstbestimmung zu bewahren. Vielen fällt es nicht leicht, sich in die Obhut anderer zu begeben. Ich sage ihnen dann: Hilfe anzunehmen ist kein Aufgeben der eigenen Autonomie. Ich glaube sogar, dass es gewisse Voraussetzungen braucht, damit ein Mensch überhaupt er selbst sein kann. Dazu gehört, dass er frei ist von starken Schmerzen.
Immer mehr Menschen fürchten den demografischen Wandel – unter anderem, weil sie Sorge haben, im Alter schwerstkrank und nicht ausreichend versorgt zu sein. Eine berechtigte Angst?
Die derzeitige Versorgung ist gut – nicht nur dank der stationären Hospize, auch durch die ambulanten Hospizdienste und die ambulante Palliativversorgung, die immer weiter ausgebaut wird. Da aber immer mehr Menschen immer älter werden und auch immer mehr Menschen in Single-Haushalten leben, ist schwer zu sagen, ob das in 20 Jahren auch noch so sein wird. Ich kann die Sorge also durchaus nachvollziehen.
Die meisten Menschen wünschen sich, zu Hause zu sterben. Tatsächlich sterben fast zwei Drittel im Krankenhaus.
Ein Widerspruch, den die ambulante Versorgung zu einem großen Teil auflösen kann. Die Betreuung zu Hause, etwa durch ambulante Pflegedienste, spezialisierte ambulante Palliativversorgung und ambulante Hospizdienste, muss deshalb noch weiter ausgebaut werden. Es wird aber immer auch Umstände geben, die eine ausreichende Betreuung zu Hause unmöglich machen. Dann zum Beispiel, wenn ein Mensch so krank ist, dass zusätzlich rund um die Uhr jemand für ihn da sein muss und es keine Angehörigen gibt, die das leisten können. Für sie ist das stationäre Hospiz oft die beste Alternative zum eigenen Zuhause.
Wie sehr hat die Politik das Thema auf dem Schirm?
Seit mehr als zwei Jahren gibt es das Hospiz- und Palliativgesetz von Gesundheitsminister Hermann Gröhe, das viele Verbesserungen gebracht hat, unter anderem für die Finanzierung von stationären und ambulanten Hospizen. Bürokratisch ist jetzt einiges weniger kompliziert, was die Zusammenarbeit zwischen Pflege, Hospiz und Palliativmedizin leichter macht. Allerdings gibt es immer noch große Lücken. Die größte sind die Pflegeheime, die gewissermaßen vergessen wurden von dem Gesetz. Der neue Koalitionsvertrag von Union und SPD versucht da nachzubessern. 8000 neue Pflegestellen sollen geschaffen werden. Das ist natürlich immer noch viel zu wenig, aber zumindest ein Anfang. Und man muss auch sehen: Selbst wenn man das Geld für 30 000 Stellen hätte, könnte man die gar nicht besetzen, weil es gar nicht genug Fachkräfte auf dem Markt gibt.
Warum wollen so wenige Menschen in der Pflege arbeiten?
Meiner Erfahrung nach ist das große Problem die mangelnde Wertschätzung. Politiker denken ja schnell, sie müssten nur mehr Geld zur Verfügung stellen und das Problem sei gelöst. Ich glaube, es braucht einen ideellen Wandel. Der Wert des Pflegeberufs für eine Gesellschaft ist nicht hoch genug einzuschätzen. Es muss uns gelingen, diese belastende, auch körperlich sehr harte Arbeit angemessen zu würdigen, damit es attraktiver ist, sie auszuüben.
Kann man sich auf das Sterben vorbereiten?
Organisatorisch auf jeden Fall. Ich rate dazu, sich frühzeitig über die verschiedenen Möglichkeiten der Sterbebegleitung zu informieren. Ansonsten wohl auch seelisch. Meine Erfahrung als Arzt ist: Wir sterben, wie wir gelebt haben. Menschen, die im Leben zufrieden sein konnten, die innerlich zu einer gewissen Ruhe und Ausgeglichenheit finden konnten, die können auch gut gehen. Umgekehrt ist es genauso: Menschen, die gehadert haben, die sich nicht gut abfinden konnten mit den Dingen, die sich ihrer Kontrolle entziehen, denen fällt es auch schwerer zu sterben. Wenn es uns gelingt, eine positive Grundeinstellung zu unserem Leben zu finden, wenn wir es schaffen, Frieden zu schließen mit den Menschen um uns herum und mit uns selbst, dann macht das nicht nur das Leben einfacher, sondern auch das Sterben.
Winfried Hardinghaus ist Arzt für Innere Medizin und Palliativmedizin. Seit dreieinhalb Jahren leitet der 67-Jährige den Deutschen Hospiz- und Palliativverband.
Quelle: